Hatespeech macht weder vor dem Internet noch vor Freiburg Halt. Rechtlich vorzugehen ist schwierig, obwohl Hasskommentare zur Anzeige gebracht werden können. Das zeigt ein Recherchebericht.
Beleidigende Äusserungen, rassistische Kommentare: Der ein oder andere ist im Internet sicher schon einmal in einer Kommentarspalte einer Newsplattform oder auf den sozialen Medien darüber gestolpert. Dieses Phänomen wird allgemein unter dem Begriff Hatespeech, zu Deutsch Hassrede, zusammengefasst. Es ist zu einem weitverbreiteten Problem geworden, wie das Schweizer Projekt «Stop Hatespeech» auf seiner Website schreibt.
Auch der Kanton Freiburg kennt Fälle von Hatespeech. Der Freiburger Grossrat Ivan Thévoz (EDU) äusserte sich kürzlich auf Facebook queerfeindlich in den Kommentaren. Er bezeichnete Mitglieder der LGBT+-Gemeinschaften als «Schwuchteln». Die Trans- und Nichtbinärvereinigung Freiburg reichte daraufhin Strafanzeige bei der Freiburger Staatsanwaltschaft ein (die FN berichteten).
Relativ neuer Begriff
Opfer haben es nicht immer leicht, gegen Hassreden vorzugehen. Das Hauptproblem besteht darin, dass Hatespeech ein relativ neuer Begriff ist, unter dem verschiedene Arten von Äusserungen und Beleidigungen zusammengefasst werden. Ausserdem gibt es diesen Begriff im Strafgesetzbuch gar nicht, wie Murielle Decurtins, Kommunikationsverantwortliche der Staatsanwaltschaft Freiburg, auf Anfrage der FN schreibt. «Der Begriff Hatespeech kann zahlreiche Straftaten zusammenfassen.» Das heisst, es hängt vom Inhalt des Kommentars ab, ob und wie der Verfasser oder die Verfasserin verfolgt werden kann.
«Der Begriff Hatespeech kann zahlreiche Straftaten zusammenfassen.»
Murielle Decurtins, Kommunikationsverantwortliche Staatsanwaltschaft Freiburg
Wenn es sich um diskriminierende Äusserungen gegen ein Kollektiv handelt, ist es möglich, dass sie gegen die Diskriminierungsstrafnorm Artikel 261bis im Strafgesetzbuch verstossen und mit Freiheitsentzug bis zu drei Jahren bestraft werden. Nicht nur Opfer können ihren Fall bei der Polizei zur Anzeige bringen. Wenn eine ganze Gemeinschaft rassistisch verunglimpft wird und es keine geschädigte Person per se gibt, kann jeder einen solchen Kommentar anzeigen. Da es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt, müssen die Behörden ermitteln, ob tatsächlich eine Straftat vorliegt oder nicht.

Symbolbild: Keystone
Komplizierte rechtliche Ausgangslage
Anders ist es, wenn Hassreden eher in Richtung des Tatbestandes der Beleidigung, Verleumdung, üblen Nachrede und Bedrohung gehen. Auch diese «Straftaten gegen die Ehre» können zwar nur auf Antrag verfolgt werden, doch muss der Antrag zwingend von jener Person gestellt werden, gegen die sich die betreffende Behauptung richtet, wie Murielle Decurtins erklärt. Wann der Inhalt für eine Verurteilung reicht, kann nicht verallgemeinert zusammengefasst werden, sondern wird bei jedem konkreten Fall analysiert.
Diese komplizierte rechtliche Ausgangslage führt dazu, dass nicht nur bei den Opfern Unsicherheit besteht, sondern auch bei den Stellen, die eine Anzeige zu Hatespeech entgegennehmen. Dies zeigt eine Ende Mai publizierte Recherche von Reflekt, einem investigativen, unabhängigen und gemeinnützigen Schweizer Rechercheteam. Dieses hat anhand von fingierten Stichproben aufgezeigt, dass auf vielen Polizeiposten das grundlegende Wissen zur Schweizer Diskriminierungsstrafnorm fehlt.
Dazu haben die Reporterinnen und Reporter in Deutschweizer Kantonen und auch in Freiburg antisemitische, queerfeindliche und rassistische Kommentare zur Anzeige gebracht. Nur 16 von 34 Polizeiposten haben die Anzeige entgegengenommen, so die Recherche. Eine Mehrheit wurde verweigert oder nicht bearbeitet. Am häufigsten begründeten die Beamtinnen und Beamten ihre Ablehnung der Anzeige damit, dass eine Anzeige nur von der Person gemacht werden könne, die vom Hasskommentar selbst betroffen sei. So argumentierten beispielsweise Polizistinnen und Polizisten in Stans, Einsiedeln, Zug und Zürich.
Nicht von Meinungsfreiheit gedeckt
Zahlreiche Beamte fanden, dass die vorgelegten Kommentare nicht strafbar, sondern von der Meinungsfreiheit gedeckt seien, so die Recherche. So auch der Fall in Freiburg.
In der Stadt Freiburg fragte die Polizistin zuerst, ob der Anzeigesteller von den Kommentaren betroffen sei. Als dieser verneinte, sagte sie, er könne keine Anzeige erstatten. Sie merkte an, dass sie die Aussagen nicht so schlimm fände und diese durch die Meinungsäusserungsfreiheit gedeckt seien. Sie schlug vor, er solle sein Anliegen direkt bei der Staatsanwaltschaft platzieren. Ausserdem müsse er als Anzeigesteller die Anzeige an die Staatsanwaltschaft übermitteln, das könne die Polizei nicht tun. Sie händigte dem Reporter daraufhin einen ausgedruckten Strafantrag aus, den er per E-Mail einsenden könne. Auf dem Formular stand jedoch ganz klar: «Anträge werden per E-Mail nicht entgegengenommen.»
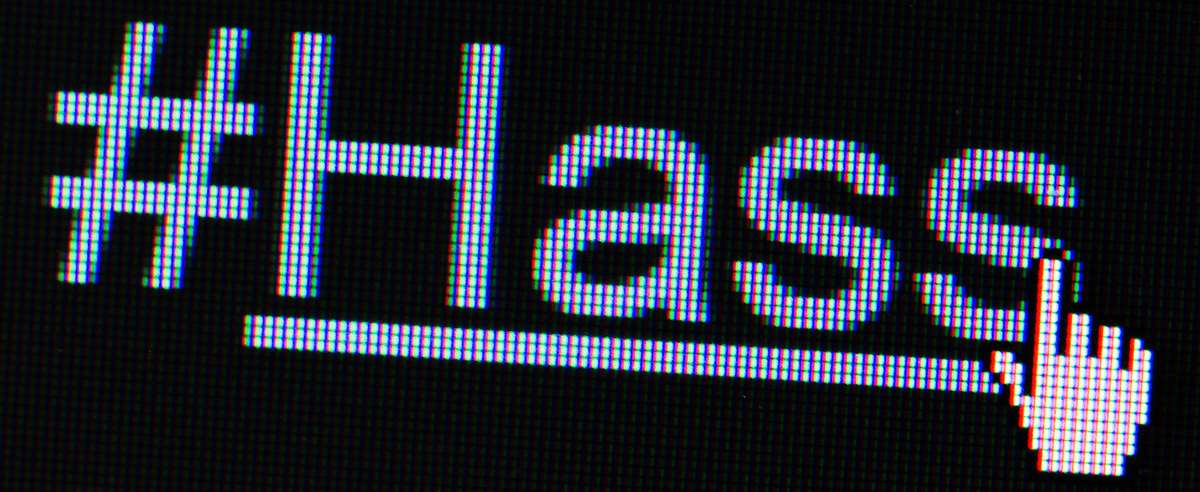
Symbolbild: Keystone
Staatsanwaltschaft oder Polizei?
Dieser Fall zeige laut dem Reflekt-Team, dass das Verhalten der Freiburger Polizeibeamtin nicht dem korrekten Vorgehen entsprach. Denn die Polizei sei laut Recherchen der richtige Ort, um Anzeige zu erstatten.
Murielle Decurtins von der Freiburger Staatsanwaltschaft präzisiert: «Bezüglich der Straftaten gegen die Ehre wird die geschädigte Person tatsächlich aufgefordert, ihre Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft einzureichen.» Bei der Diskriminierungsstrafnorm gilt allerdings: «Der Tatbestand zählt nicht zu den Ehrverletzungen, deshalb kann die Anzeige sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden.»
Die Kantonspolizei sagte gegenüber dem Reflekt-Team: «Die Anzeige hätte am besagten Tag aufgenommen werden müssen.»
Das Rechercheteam von Reflekt hat bei den 16 Fällen, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden, nach dem Stand des Verfahrens gefragt. In neun Kantonen leitete die Staatsanwaltschaft in mindestens einem der gemeldeten Fälle ein Strafverfahren ein. Nur Schaffhausen bestätigt, dass ein Urteil gesprochen wurde. In zwei Kantonen sei das Verfahren nach Kenntnis des Reflekt-Teams noch hängig. Ein weiterer Kanton hat das Verfahren sistiert.
Was ist Hatespeech?
Als Hatespeech werden schriftliche und verbale Äusserungen bezeichnet. Diese können sich gegen eine bestimmte Personengruppe oder gegen Einzelpersonen richten. Das Ziel: Die Personengruppe oder Einzelperson zu beleidigen, beschimpfen, abwerten, herabwürdigen, verunglimpfen, verspotten, lächerlich machen. Also kurz: zu diskriminieren. So lautet die Definition in der Broschüre der Schweizerischen Kriminalprävention, eine interkantonale Fachstelle der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren. Vor allem im Internet, in den sozialen Medien, in Blogs und in Internetforen ist Hatespeech laut der Fachstelle mittlerweile weit verbreitet. Dies auch wegen der vermeintlichen Anonymität im Netz.
Es gibt jedoch weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene eine einheitliche rechtliche Definition des Begriffs Hatespeech. (agr)
Hatespeech zur Anzeige bringen
Wer Hatespeech im Internet zur Anzeige bringen will, sollte ein paar Dinge beachten. Der Verein «#Netzcourage», der sich gegen digitale Gewalt engagiert, empfiehlt, die «Attacke» zu dokumentieren. Das bedeutet beispielsweise Screenshots machen, bei denen Datum, Uhrzeit und die Plattform ersichtlich sind.
Das Reflekt-Team gibt auch einige Empfehlungen ab. Verstösse gegen die Diskriminierungsstrafnorm müssen in ausgedruckter Form auf dem Polizeiposten zur Anzeige gebracht werden, auch wenn diese online erfolgt sind. Memorysticks mit digitalen Beweisstücken oder E-Mails mit Anhängen nehmen die Beamten aus Sicherheitsgründen nicht gern entgegen. (agr)









Kommentar (0)
Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.