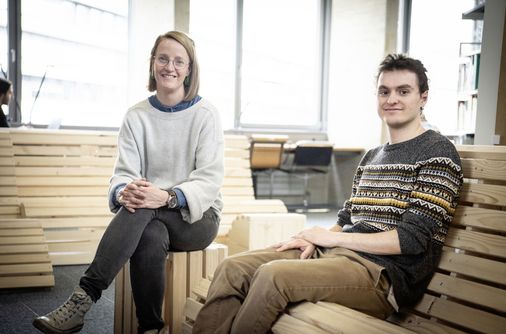Wenn Nationalisten Grenzen definieren
Philipp Haselbach leistet mit seiner Lizentiatsarbeit einen Beitrag zur Freiburger Sprachgeschichte
Für die Sprachgrenze im Kanton Freiburg haben sich lange vor allem Nicht-Freiburger interessiert – und oft nicht gerade neutral, wie der Historiker Philipp Haselbach aus Marly festgestellt hat. Im Rahmen seiner Lizentiatsarbeit hat er die Sprachenfrage für die Zeit zwischen 1890 und 1960 untersucht.
Noch 1848, anlässlich der Gründung des Bundesstaates, hatte man den Sprachgrenzen kaum Bedeutung beigemessen, erklärt Philipp Haselbach seinen «Einstieg» kurz vor der Jahrhundertwende. Danach seien aber neben dem klassischen Nationalstaat par excellence – Frankreich – nördlich und südlich der Schweiz mit Deutschland und Italien Staaten entstanden, die sich ihren Platz in Europa mit einem gesteigerten Nationalgefühl eroberten. Mit der Sprache als einendem Faktor.
Im Deutschen Reich und in den deutsch-freundlichen Kreisen der Schweiz begann man sich die Frage nach Grenze und Umfang des eigenen «Volksbodens» zu stellen, dessen Grenzabschnitt auch durch den Kanton Freiburg führte. «Selbsternannte Sprachforscher wie Jakob Zimmerli, der Lehrer und Hausforscher Jakob Hunziker, Eduard Blocher vom Deutschschweizerischen Sprachverein (DSSV), aber auch alldeutsche Geopolitiker wie Johannes Zemmrich und Wilhelm Groos befassten sich mit Verlauf und Gestalt der Sprachgrenze im Kanton Freiburg», weiss Philipp Haselbach.
«Spielball der Sprachnationen»
Wenn Vertreter des DSSV oder ethno-linguozentrischer Gruppierungen in Deutschland über die Sprachräume schrieben, geschah dies zumeist in polemischem Stil, wie der 29-jährige Historiker schnell einmal erkennen musste. Die (sprachnationalistischen) Autoren weiteten das deutsche Sprachgebiet meist «grosszügig» aus – etwa durch Einbezug «einst deutschsprachiger» Gebiete. Und deutschsprachige Minderheiten wurden zu germanischen Vorposten.
In seiner Arbeit hat Philipp Haselbach aber nicht nur deutschsprachige Literatur untersucht: Auf welscher und französischer Seite habe man Gegensteuer gegeben, um den aus deutschen Kreisen proklamierten «einzig wahren» Verlauf der Sprachgrenze ins rechte Licht zu rücken, sagt der Historiker. «Der Kanton Freiburg wurde so zum Spielball der Sprachnationen.»
Insbesondere Albert Dauzat, einer der bekanntesten Sprachforscher der «Grande Nation», aber auch der Neuenburger Professor Charles Knapp seien für die Sache der Frankophonie eingestanden. Die Westschweizer hätten sich aber manchmal vom grossen Nachbarn im Westen vernachlässigt gefühlt.
«Man bezichtigte sich regelmässig über die Sprachgrenze hinweg der fehlerhaften Untersuchungsmethoden oder des Grossmachtsdenkens, um den eigenen geopolitischen Ansichten jeweils einen seriöseren Anstrich geben zu können», hält Philipp Haselbach fest. Gemässigtere Forscher wie der Zürcher Professor für romanische Sprache Heinrich Morf hatten dabei einen schweren Stand.
Schweissnaht Sprachgrenze
Die Sprachgrenze als eine die Völker klar voneinander scheidende Linie – das war das Bild, das von der Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg noch vorherrschte. Jakob Hunziker etwa habe sich mit schwammigen Ausdrücken beholfen und dadurch Aussenstehenden den Eindruck vermittelt, dass Seebezirk und Stadt Freiburg sprachlich genau aufgeteilt waren. «Deutsche und französische Sprachwissenschaftler wanderten damals die Freiburger Sprachgrenze ab und verrannten sich oft in naturromantischen und volksmythischen Ergüssen», urteilt Philipp Haselbach.
Während der Geistigen Landesverteidigung wurde die Sprachgrenze dann offiziell als das Land zusammenhaltende Schweissnaht betrachtet: An der Landi 1939 wies man auf die Brückenfunktion des Kantons Freiburg hin – eine Aufgabe, die im Seebezirk schon 1926 anlässlich der Murtenschlachtfeier vorweggenommen worden sei.
Freiburger zeigen wenig Interesse
Was sagte man eigentlich in Freiburg zur eigenen Sprachgrenze, die in der übrigen Schweiz zu heftigen geopolitischen Auseinandersetzungen führte? «Freiburger Stimmen liessen sich kaum hören und gingen in den Diskussionen zwischen den Sprachnationen weitgehend unter», erklärt Philipp Haselbach, der selber an der Sprachgrenze aufgewachsen ist.
Nur Ferdinand Buomberger, Direktor des kantonalen Statistischen Amtes, der ebenfalls aus der Ostschweiz stammende Universitätsprofessor Albert Büchi, der Romancier Léon Savary, die FN und zuweilen auch Gonzague de Reynold befassten sich damals mit diesem Gegenstand. «Allerdings selten.»
Erst in der Zwischenkriegszeit trat mit Johann Piller, dem damaligen Vorsteher des kantonalen Arbeitsamts, jemand auf den Plan, der sich unermüdlich mit den hiesigen Bevölkerungsverhältnissen beschäftigte und dabei auch die Sprachenlage streifte. Hintergrund für seine statistischen Studien bildete die damalige katastrophale Wirtschaftslage. Diese sieht Philipp Haselbach auch als einen der Gründe für das begrenzte Interesse der Freiburger: Unterschwellig sei bei den Deutschfreiburgern schon eine Unzufriedenheit vorhanden gewesen. «Sie hatten aber dringlichere Probleme. Arbeitslosigkeit, Hunger.»
Emanzipation
Erst mit dem Aufbruch in den 50er Jahren und der damit einhergehenden verstärkten Emanzipation Deutschfreiburgs kam es zu einer um Jahrzehnte verspäteten, breit abgestützten Behandlung der territorialen Sprachenfrage, wobei insbesondere der Sensler Landarzt und Schriftsteller Peter Boschung, der deutsche Professor Ludwig Bernauer und der Murtner Schuldirektor Ernst Flückiger sich damit befassten. Und dies auch nicht immer gerade neutral.
In der übrigen Schweiz war man mittlerweile auf der Stufe der gemässigt-wissenschaftlich geographischen oder juristischen Untersuchung der Sprachgrenze angelangt, führt Philipp Haselbach aus. In den 60er Jahren endet seine Studie. Die territoriale Sprachenfrage in Freiburg trete hier in eine akutere Phase, sei «gewissermassen aus der lethargischen Vorstufe» ausgebrochen.
Pascal Aebischer
Die Sprachenfrage im Freiburger Alltag
Wo, auf welche Weise und zu wessen Gunsten verschob sich die freiburgische Sprachgrenze zwischen 1890 und 1960? Und falls sie es tat – wurden diese Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte im öffentlichen Leben Freiburgs als Sprachenfrage wahrgenommen? Diese Aspekte wurde im zweiten, grösseren Teil der Lizenziatsarbeit untersucht. Sie befasst sich dabei mit den drei Bereichen Geburtenüberschuss, Migration und Assimilation.
Schon deren Messung stellte die Sprachforscher allerdings vor Probleme. So wurde die Muttersprache in den alle Dekaden stattfindenden Volkszählungen oft umterschiedlich definiert, und in den Fragebögen wurde auch nicht nach der Umgangs- oder Alltagssprache gefragt. Schon anfangs dieses Jahrhunderts hat Jakob Zimmerli auf das Ungenügen dieser Zählungen im Sprachgrenzgebiet hingewiesen und gar behauptet, dass man z. B. im Falle von Merlach die Fragebögen manipuliert habe.
Migration
Dieser Teil der Arbeit befasst sich auch mit der Frage, wie sich die wirtschaftliche und die damit einhergehende Entwicklung der Verkehrswege (bessere Vernetzung, Modernisierung der Verkehrsmittel etc.) auf die Migration und damit auf die Zusammenset